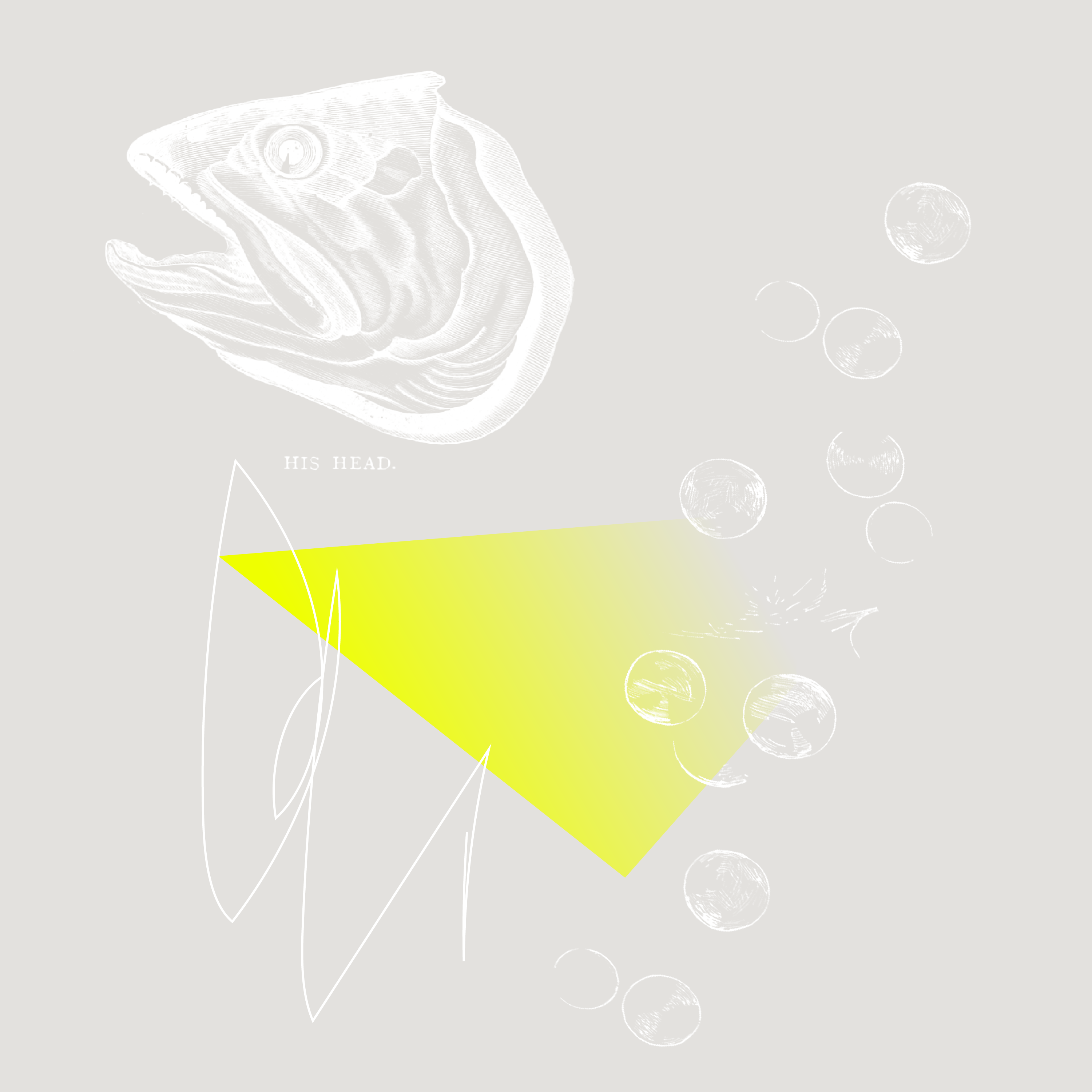

Begriffe2go
Begriffe2go
Die folgende Sammlung greift aktuell diskutierte Begriffe auf und erläutert sie in kompakter Form. Es geht um den Unterschied zwischen „digitalem Wandel“ und „Digitalisierung“, die Bedeutung von „post-digital“ und „digitaler Partizipation“, aber auch darum, was unter einem „Prompt“ zu verstehen ist und warum er im Umgang mit KI eine entscheidende Rolle spielt.
Prompt
In der Psychologie bezeichnen ‚Prompts‘ Aufforderungen, die spezielle Gedächtnisinhalte abrufen sollen. Auch im Bildungskontext wird der Begriff genutzt. Hier geht es um kurze Hinweise oder Ausführungsanleitungen, mit denen Lernprozesse angeregt werden. Mit dem Aufkommen und der Diskussion um KI-basierte Chatbots hat sich der aus dem Englischen stammende Begriff (to prompt = veranlassen) auch in Deutschland verbreitet.
Im Bereich der IT, in der der Begriff schon eine längere Tradition hat, und vor dem Hintergrund aktueller KI-Entwicklungen geht es bei einem Prompt darum, die richtigen Fragen und Aufforderungen zu formulieren, um geeignete Ergebnisse zu erhalten. Es handelt sich also um eine Eingabeaufforderung, die einen Computer oder eine KI-Anwendung instruiert, eine bestimmte Aufgabe zu erledigen. Diese Aufforderung kann je nach zugrunde liegender KI in Form von Satzfragmenten, Stichworten oder komplexer ausformulierten Aufgabenstellungen erfolgen.
Prompt-Engineering, d. h. die Kunst, die richtigen Fragen zu stellen, wird immer häufiger als wichtige Zukunftskompetenz beurteilt und erweitert die Bedienfertigkeit der Nutzer*innen um eine neue Dimension. Dabei geht es um die Fähigkeit, einer Maschine ‚die richtigen‘ Anweisung zu erteilen, die diese in eine mathematische Darstellung übersetzen kann. Denn obwohl v. a. Chatbots den Eindruck menschlicher Interaktion vermitteln, handelt es sich tatsächlich um die Schnittstelle zwischen den Nutzer*innen und dem zugrunde liegenden Sprachmodell, das als KI bezeichnet wird. Zielführende Prompts sollten grundsätzlich klar und präzise formuliert sein, das Wichtigste betonen und auf das Hauptanliegen fokussiert sein.
Digitaler Wandel und Digitalisierung
‚Digitaler Wandel‘ und ‚Digitalisierung‘ sind gängige Begriffe, die im Alltag häufig synonym verwendet werden. Doch was ist eigentlich der Unterschied und wie werden die beiden Begriffe definiert?
Grundsätzlich wird angenommen, dass sich der Begriff der ‚Digitalisierung‘ auf die Umstellung von analogen auf digitale Prozesse bezieht. So werden in der öffentlichen Verwaltung Arbeitsabläufe digitalisiert (zum Beispiel können Anträge für Elterngeld oder ein Führungszeugnis online gestellt werden) oder in Unternehmen digitale Medien und Systeme verwendet, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen oder Emissionen und Abfälle zu verringern.
Diese Umstellung durch neue Technologien ist auch Teil des ‚digitalen Wandels‘, allerdings spielen hier zusätzlich die damit einhergehenden sozialen Veränderungen eine zentrale Rolle. So definiert das EU-Parlament den ‚digitalen Wandel‘ als die „Integration digitaler Technologien in die Arbeitsabläufe von Unternehmen und dem öffentlichen Dienst sowie die Auswirkungen dieser digitalen Technologien auf die Gesellschaft“. Diese digitalen Technologien sind vielfältig (zum Beispiel digitale Plattformen, Blockchain oder Künstliche Intelligenz) und verändern das alltägliche Leben. Ganz wichtig ist dabei: Es sind nicht die Technologien, sondern die Menschen, die die sozialen Veränderungen realisieren, und zwar abhängig davon, wie digitale Dienste und Systeme angeeignet und genutzt werden. Es handelt sich also nicht um ein einseitiges Einwirken digitaler Technologien auf den Menschen, sondern im Zusammenwirken um eine kulturelle Transformation.
Aus diesem Grund bevorzugen wir im Projekt „Digitales Deutschland“ die Bezeichnung ‚digitaler Wandel‘, weil es uns primär um die sozialen Aspekte unterschiedlicher Digitalisierungsprozesse geht, allen voran um die Frage, welche Kompetenzen Menschen für ein souveränes Leben angesichts des digitalen Wandels brauchen. Wenn Sie an den medien- und KI-bezogenen Kompetenzen der deutschsprachigen Bevölkerung interessiert sind, liefern die Ergebnisse unserer Studien sicher gewinnbringende Erkenntnisse.
Post-digital
Der Begriff der Postdigitalität drückt aus, „dass Digitalität mittlerweile ein fester Bestandteil des menschlichen Daseins“ ist (Traulsen und Büchner 2022, S. 334). Die digitale Transformation ist also in einem Maße fortgeschritten, dass das Digitale nun eine omnipräsente und ubiquitäre Infrastruktur in unserer Welt darstellt (Jörissen 2017, Traulsen und Büchner 2022). Digital vernetzt zu sein, ist nichts Neues mehr. Außerdem verweist der Begriff darauf, dass es von spezifischen Kontexten abhängt, in die digitale Technologien eingebettet werden, was Digitalität mit uns macht und umgekehrt.
Mit dem Begriff erkennen wir einen Zustand an, in dem digitale Medientechnologien nicht mehr als Störung einer analogen Welt, sondern als Merkmal unseres Alltags gelten. Heutzutage sind Dichotomien wie ‚digital‘ versus ‚analog‘ nicht länger tragfähig, da beides auf komplexe Art und Weise miteinander verwoben ist. Mit solchen Unterscheidungen lässt sich die heutige Gesellschaft nicht mehr treffend beschreiben (Cramer 2014).
Zugleich ist der Begriff der Postdigitalität eine diskursive Position – genauer eine Gegenposition zur aktuellen Debatte um Digitalisierung. Denn durch die Benennung von Postdigitalität kann sich der Fokus verschieben. Er ermöglicht, nicht nur technologische Aspekte unserer Gesellschaft zu betrachten, sondern insbesondere auch soziotechnische Verflechtungen und Veränderungen auf institutionellen, gesellschaftlichen oder kulturellen Ebenen sowie Dimensionen von Macht, Herrschaft oder Ungleichheit kritisch zu hinterfragen (Traulsen und Büchner 2022, S. 335.).
Digitale Partizipation
Aus einer eher politikwissenschaftlichen Perspektive heraus wird – angelehnt an Konzepte der Partizipationsforschung – unter ‚digitaler Partizipation‘ die freiwillige Einflussnahme auf politische Entscheidungen mithilfe digitaler Infrastrukturen und Angebote verstanden. Eher konventionelle Beispiele hierfür sind die Teilnahme an Online-Abstimmungen bei kommunalen Planungsverfahren oder digitalen Bürgersprechstunden.
Aus einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive heraus wird unter ‚digitale Partizipation‘ allgemeiner die Teilhabe und Teilnahme an der digitalen Gesellschaft gefasst. Dies impliziert auch die Beeinflussung politischer Entscheidungen, folgt aber übergreifend dem Ideal, das gesellschaftliche Zusammenleben aktiv zu gestalten. In diesem Sinne ist digitale Partizipation der digital vermittelte Zugang zu verschiedenen Lebensbereichen (vgl. Hartung-Griemberg und Bogen 2023) und umfasst unterschiedliche Dimensionen: existierende Zugangsmöglichkeiten; die Bereitschaft, eigene Kompetenzen einzubringen; das aktive Mitgestalten und -entscheiden sowie die soziale Anerkennung der Zugehörigkeit (vgl. Kardoff 2014; Hartung-Griemberg und Bogen 2023). Konkreter geht es u. a. etwa um das Recht, Bildungsprozesse mitzugestalten (vgl. Bubolz-Lutz et al. 2010, S. 63) ebenso wie Technologien und gesellschaftliche Rahmenbedingungen des digitalen Wandels zu gestalten (Stubbe et al.).
Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass die Nichtnutzung entsprechender digitaler Technologien perspektivisch zur politischen und sozialen Exklusion beitragen kann. Schon heute zeigen Studien, dass sich v. a. ältere Menschen ohne Internetzugang oder jene mit mangelnden Medien- und Digitalkompetenzen vom gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt fühlen. Als Konsequenz daraus gilt es, einerseits ausreichend Angebote, Vorbedingungen und Infrastrukturen zur Befähigung zu schaffen, die Nutzung also überhaupt erst einmal flächendeckend zu ermöglichen. Andererseits sollten im Sinne der Diversität auch jenseits der Bereitstellung und tatsächlichen Nutzung digitaler Teilhabe- und Teilnahmemöglichkeiten ausreichend alternative Beteiligungsformen, -wege und -möglichkeiten gewährleistet sein, um andere nicht dauerhaft von der gesellschaftlichen Mitgestaltung auszuschließen.
Auch vor dem Hintergrund fehlender Infrastrukturen – kein flächendeckender Internetzugang, fehlende digitalisierte Verwaltungsvorgänge, unterentwickelte Assistenzangebote für unterschiedliche Bedürfnisse zur Technologienutzung – bleibt der Anspruch digitaler Partizipation bislang eher ein (bildungs-)politisches und gesamtgesellschaftliche Ideal als soziale Realität.
Motivation
Wie kommt medienkompetentes Handeln zustande? Dafür ist Motivation wichtig – und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen beeinflusst Motivation maßgeblich, wie gut etwas gelernt wird. Besonders intrinsische Motivation wirkt sich positiv auf den Lernprozess aus. Zum anderen ist Motivation notwendig, um Wissen in kompetentes Handeln umzusetzen. So kann eine Person beispielsweise über Datenschutz einiges wissen, ob sie jedoch Schritte unternimmt, die eigenen Daten zu schützen, hängt maßgeblich davon ab, inwiefern sie sich dazu in der Lage sieht und ein Interesse daran hat (Riesmeyer et al. 2016). Daher ist Motivation für Kompetenzentwicklung zentral. Doch was ist eigentlich Motivation?
Motivation fußt (laut der Selbstbestimmungstheorie) auf drei grundlegenden Bedürfnissen – den ‚basic needs‘: Kompetenzerleben/Selbstwirksamkeit, Autonomie und soziale Eingebundenheit (Deci und Ryan 1993). Günstige Selbstwirksamkeitserwartungen sind notwendig, jedoch allein nicht hinreichend für eine auf Selbstbestimmung beruhende Motivation. Je mehr Selbstwirksamkeit man empfindet, desto stärker ist man motiviert, etwas zu tun. Jedoch ist gerade in pädagogischen Kontexten nicht nur von Bedeutung, wie stark jemand motiviert ist, sondern auch, in welcher Art und Weise.
Menschen können qualitativ unterschiedlich motiviert sein. Formen von Motivation lassen sich vor allem danach unterscheiden, inwiefern sich ein Individuum als autonom erlebt. Dabei wird grundsätzlich zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation differenziert.
Es kann sein, dass Menschen lediglich – fremdbestimmt – aufgrund erwarteter Folgen (sei es Strafe oder Belohnung) handeln. Dies ist eine Form extrinsischer Motivation. Andere Ausprägungen extrinsischer Motivation zeichnen sich dadurch aus, dass sich die Gründe, etwas zu tun, von äußerem Zwang immer weiter hin zu inneren Beweggründen verschieben. Ein Beispiel dafür ist etwa, dass Menschen etwas tun, weil sie sich als Teil einer Gruppe fühlen wollen. Dies wäre eine höhere Form extrinsischer Motivation als das Handeln nur aufgrund äußeren Drucks.
Die Form von Motivation, die sich durch das höchste Maß an Selbstbestimmung auszeichnet, ist die intrinsische Motivation. Das heißt, Menschen handeln, weil ihnen etwas Freude macht oder weil sie ein Interesse daran haben.
Aus diesem Grund ist Motivation im Projekt Digitales Deutschland zentral: Sie ist ausschlaggebend dafür, ob und in welchem Maße Menschen bereit sind, die subjektiv empfundenen und gesellschaftlich wahrgenommenen Kompetenzanforderungen des digitalen Wandels mit Kompetenzerwerb und -entwicklung zu bewältigen. Denn Angebote zur Kompetenzförderung sind nur hilfreich, wenn sie auch angenommen und das erworbene Wissen im Handeln angewendet wird. Wenn entsprechende Angebote lebenswelt- und wohnortnah gestaltet sind, erhöht sich auch die Motivation, diese zu nutzen. Daher ist es wichtig, im Kontext von Medien- und Digitalkompetenz individuelle Motivationslagen zu berücksichtigen.
Literatur
- Bubolz-Lutz, E.; Gösken, E.; Kricheldorff, C. und Schramek, R. (2010). Bildung und Lernen im Prozess des Alterns. Das Lehrbuch. Kohlhammer.↩
- Deci, Edward L.; Ryan, Richard M. (1993): Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. Zeitschrift für Pädagogik 39 (1993) 2, S. 223–238. In: Zeitschrift für Pädagogik 39. DOI: 10.25656/01:11173↩
- Hartung-Griemberg, A.; Bogen, C. 2023: Digitale Partizipation im höheren Lebensalter zwischen Programmatik und Praxis. Im Rahmen des Projekts Digitales Deutschland. Online verfügbar: https://digid.jff.de/fokus-auswertung-zu-partizipation/. [https://digid.jff.de/fokus-auswertung-zu-partizipation/]↩
- Kardoff, E. von (2014). Partizipation im aktuellen gesellschaftlichen Diskurs – Anmerkungen zur Vielfalt eines Konzepts und seiner Rolle in der Sozialarbeit. Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit, 45(2), S. 4–15.↩
- Krapp, Andreas; Ryan, Richard M. (2002): Selbstwirksamkeit und Lernmotivation. Eine kritische Betrachtung der Theorie von Bandura aus der Sicht der Selbstbestimmungstheorie und der pädagogisch-psychologischen Interessentheorie. In: Matthias Jerusalem und Diether Hopf (Hrsg.): Riesmeyer, Claudia; Pfaff-Rüdiger, Senta; Kümpel, Anna (2016): Wenn Wissen zu Handeln wird: Medienkompetenz aus motivationaler Perspektive. In: M&K Medien & Kommunikationswissenschaft 64 (1), S. 36–55. Online verfügbar unter https://doi.org/10.5771/1615-634X-2016-1-36, zuletzt geprüft am 21.11.2018.↩
- Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen. Unter Mitarbeit von DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, Matthias Jerusalem und Diether Hopf. Weinheim u. a.: Beltz (Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft, 44), S. 54–82, Online verfügbar unter: https://doi.org/10.25656/01:7863, zuletzt geprüft am 04.09.2023.↩
- Stubbe, J., Schaat, S. & Ehrenberg-Silies, S. (2019). Digital souverän? Kompetenzen für ein selbstbestimmtes Leben im Alter. Bertelsmann Stiftung. https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/digital-souveraen↩
Zitation
Cousseran L., Berg K., Tausche S. 2023: Begriffe2go. Im Rahmen des Projektes Digitales Deutschland. Online verfügbar: https://digid.jff.de/magazin/diversitaet/begriffe2go-digitales-deutschland/