
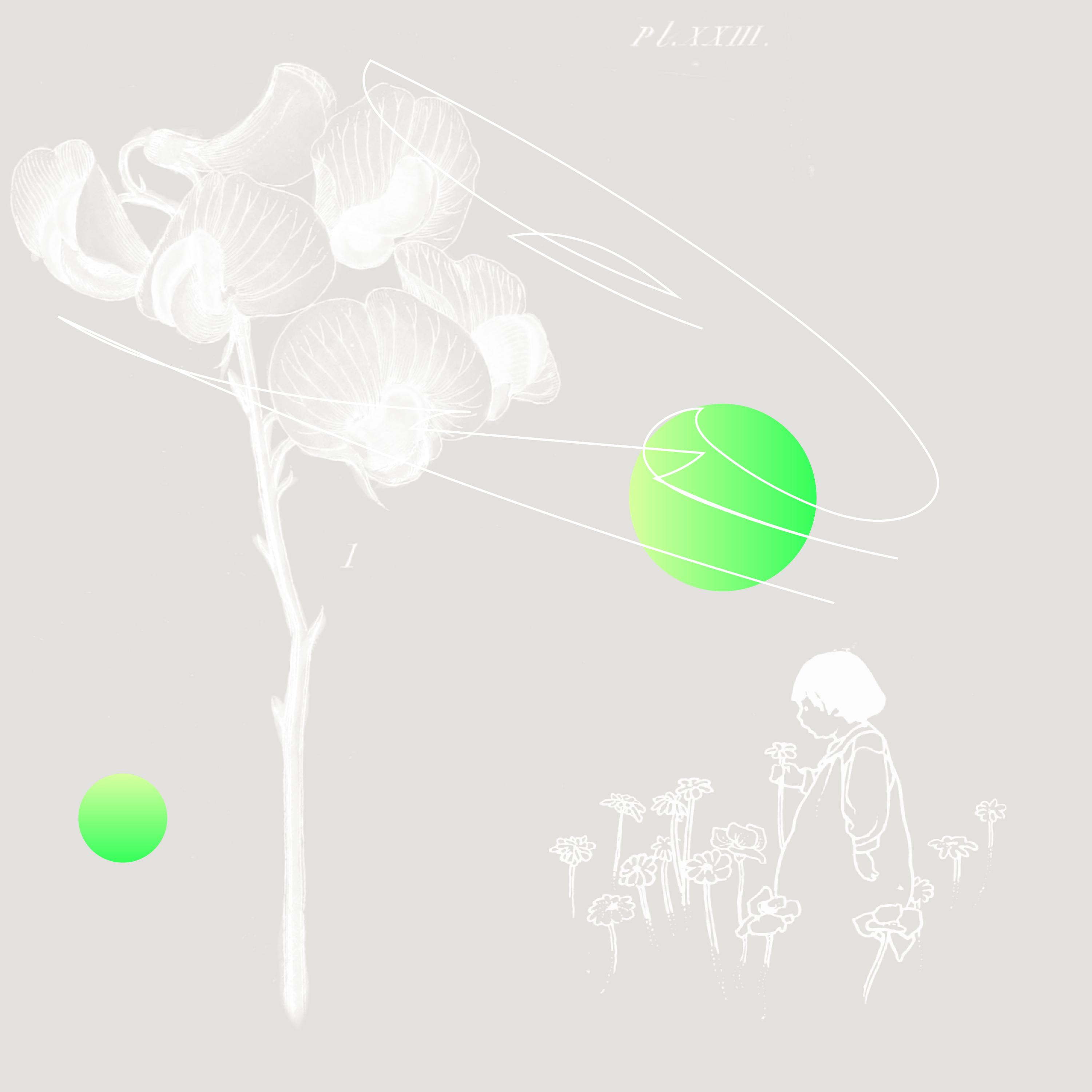
Stichwort „digitale Kreativität“ …
Stichwort „digitale Kreativität“ …
Wie viel Kreativität steckt im Digitalen? Inwieweit können wir Kreativität als menschliche Kompetenz betrachten, die gefördert werden kann? Und inwiefern beeinflussen digitale Technologien und Künstliche Intelligenz das Konzept von Kreativität? Die Redaktion von kompetent hat einen Kunsthistoriker gebeten, diese und weitere Fragen zum Zusammenhang von Kreativität, Digitalität und Kompetenz zu beantworten – Gedanken von Prof. Dr. Hans Ulrich Reck zum Thema.
„Digitale Kreativität“. In diesen zwei Worten klingt das Versprechen einer lebensfähigen und alle verbindenden Zukunft an. Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich, wie missverständlich dieser Ausdruck ist. Denn eigentlich müsste es heißen: Über Aspekte, Motive und möglicherweise auch Modelle kreativer Prozesse im Zeitalter einer Telekommunikation, die durch Apparate und Algorithmen gesteuert wird. „Digital“ bedeutet ja rein technisch zunächst nur, dass Zeichenketten so umgewandelt oder verfasst werden, dass Maschinen sie lesen können. Dieses Lesen ist jedoch ein anderes, als das mit Interpretation verbundene Lesen durch Menschen.
Fragen wir also nach Zuständen oder Phänomenen von „Kreativität“ heute. Inzwischen grassiert die Rede vom „Kreativen“ allenthalben und überall. Ich will sofort klarstellen, dass ich überhaupt nichts gegen einen alltäglichen Gebrauch des Adjektivs „kreativ“ einzuwenden habe, auch wenn meine Bemerkungen im Folgenden kritisch angelegt sind. Man kann akzeptieren, was historisch geworden und aktuell dominierende Gewohnheit ist. Sofern man sich nicht weigert, eine komplexe Geschichte hinter dem Wort wahrzunehmen. Interessanterweise gibt es nämlich erst seit dem 19.Jahrhundert ein Bewusstsein oder einen Anspruch, kreativ in unserem Sinne, also individuell produktiv oder „schöpferisch“ zu sein. Das ist eine Findung von (ausschließlich männlichen) Künstlern gewesen.
Im 20. Jahrhundert hat der Diskurs des Kreativen nahezu alles ab- und aufgelöst, was früher unter dem Anspruch eines Schöpferischen in Ästhetik und Philosophie geäußert worden ist. Es ist dabei ganz offensichtlich, dass ein „Schöpferisches“ anspruchsvoller ist als die Behauptung des „Kreativen“. Denn schöpferisch zu sein, bedeutet, seine Bedingungen substanziell zu überschreiten. Es bezieht sich auf eine Transformation, also einen Prozess. Wohingegen die Behauptung, man sei kreativ, auf eine statische Eigenschaft verweist, auf etwas, das ganz einfach da ist – angeblich. Dieser Sprachgebrauch hat sich von der Mitte des 20. Jahrhunderts an als der maßgebliche etabliert. Er- oder gefunden worden ist er von US-amerikanischen Psychologen wie J. P. Guilford, W. J. J. Gordon und anderen. Ihr Ansatz hatte einen sozialen und politischen Hintergrund. Zum einen erwiesen Intelligenztests, die regelmäßig von der US-amerikanischen Armee durchgeführt wurden, dass Schwarze schlechter abschnitten als Weiße. Da sie aber als Soldaten unverzichtbar patriotische US-Bürger waren – zudem genau so intelligent, tapfer und zuverlässig wie die Weißen – und man ja wusste, dass die soziale Herkunft natürlich eine Auswirkung auf die durch Bildung modellierte Intelligenz hat, suchte man nach anderen Faktoren und Aspekten, die man in das Bild einer reifen Persönlichkeit über die kognitiv eingeschränkte Intelligenz hinaus einbeziehen konnte.
Man fand dann und bezog in die Bewertung von Kreativität zusätzlich zur Intelligenz im traditionellen engeren Sinne ein: Problemlösungsfähigkeit, Aufmerksamkeit, Agilität, Einfallsreichtum und dergleichen mehr. Man ließ also in die Persönlichkeitsbewertung kognitive wie außerkognitive, moralische und ästhetische Kriterien einfließen. Das war die Geburtsstunde des bis heute wirkenden Begriffs der „Kreativität“, der sich in vielen Nuancierungen auf verschiedene, wesentlich breiter gefasste Kontexte beziehen konnte als es die rein kognitive Intelligenz zuließ.
Von da an wurden die Grenzen des „Kreativen“ immer weiter verschoben. Immer weitere Bereiche außerhalb von Kunst und dem angestammten gestalterischen Erfindungsreichtum waren nun „kreativitätsfähig“ – bis zu guter Letzt das Wort nur noch für eine einzige Behauptung steht: Nicht den Ausweis einer transformierenden erzeugenden Tätigkeit, sondern ein ruhiges So-und-nicht-anders-Sein, ein Selbst-Sein, ein zufriedenes Bei-sich-selbst-sein-Wollen.
Allerdings: Alltäglich darf man sich getrost die bekannte pädagogische Situation positiv vor Augen halten und den elementaren Anspruch an Kreativität als Aufforderung verstehen: „Betrachte die Sache doch einmal anders“, „Weiche von deinen fixen Einschätzungen ab“, „Lass dir etwas anderes einfallen, selbst wenn es abwegig erscheinen sollte“, „Sei agil und nicht stur“. Damit ist klar, dass „kreativ“ nichts Objektives mehr meint, sondern einen individuellen Bereich, der gar singulär sein kann. Und dies in wertfreier, nicht-normativ gebundener Hinsicht: Ich kann nämlich für mich kreativ sein, auch wenn dies anderen als völlig gewöhnlich und trivial erscheint. Mit einem übergreifenden Anspruch an die Definition von „Kreativität“ kommt man schnell auf die schiefe Bahn und in Teufels Küche. Wenn man das ernst nimmt, dann ist kreativ nämlich nur etwas, was als singuläre Leistung in einer Weise auftritt, welche die überwiegende Mehrheit der Menschen überhaupt nicht verstehen, geschweige denn selbst entwerfen kann. Wäre dies der Fall, dann wäre es gerade nicht mehr kreativ, sondern ein allgemeines Vermögen, etwas Gewöhnliches und nicht nur etwas Gewohntes. Daran merkt man aber auch, dass man gut beraten ist, vorschnelle Bewertungen aus der Wahrnehmung, Diskussion und Erörterung des „Kreativen“, seiner Phänomene und Aspekte herauszuhalten.
So weit der aktuelle Wortgebrauch. Wie sieht die Vorgeschichte aus? Es entsteht ein Anspruch an eine individuelle oder „menschengemachte“ Kreativität erst im Prozess der Modernisierung seit der Renaissance. Das Wort blieb früher Gott vorbehalten. Gott ist der „creator“. Und man muss hinzufügen: der einzige „Schöpfer“. Erst unter dem Einfluss anspruchsvoller und grenzenlos agieren wollender Künstler*innen seit der Renaissance entwickelt sich nach und nach der Anspruch, gottähnlich erzeugend schöpferisch zu sein, also einer produzierenden (generativen) und nicht einer erzeugten Natur anzugehören. Bis sich das durchsetzte und im Pathos eines 18-jährigen Arthur Rimbaud gipfelte, man müsse jeden Tag eine neue Sprache, ja eine neue Welt erfinden, vergingen aber doch noch 450 Jahre.
Und was hat es nun mit der „digitalen Kreativität“ auf sich? Man muss davon ausgehen, dass „das Digitale“ mit dem Kreativen nichts Spezifisches zu tun hat. Oder auch haben muss. Digital sind heute von Apparaten gesteuerte Apparate-Verbünde zur Verarbeitung und Nutzung riesiger Datenerhebungen, die in numerische Ketten von 0-1-Ziffernfolgen umgewandelt werden. Spezialist*innen wissen, dass man Computer seit etwa 30 Jahren nicht „verstehen“ kann und dass das Modell, dass Menschen und Computer sich darin ähneln, dass beide Symbole verarbeiten, bis Erkenntnisse daraus werden, falsch ist, unbefriedigend zumindest, weil es nicht erklärt, was es erklären soll. Der Mensch und sein Gehirn sind nicht mehr die übergeordneten Autoritäten oder Befehlsgeber, die alles vorkonzipieren, überschauen und im Griff haben. Neue These: Man müsse nur ausreichend viele Computer zusammenschalten, dann würden diese selber arbeiten, programmieren, agieren. Es gibt keine Steuerungsinstanz mehr, keinen Befehlsgeber, keinen universalen Algorithmus, keine Kommandobühne, kein humanes Meistergehirn, das vorgibt, was die Geräte dann hierarchisch abarbeiten würden.
Salopp ausgedrückt: Die Maschinen machen inzwischen, was sie wollen, und vor allem, was sie können. Und sie können sehr vieles. Den meisten Menschen scheint inzwischen vollkommen egal zu sein, dass sie keine geschützte Persönlichkeitssphäre mehr haben können. Sie wollen sie auch nicht. Dagegen bleibt zu fragen, welche Art von Kreativität gegen die hegemoniale Normierung und Uniformierung durch die digital selbstläufigen Apparate heute noch denkbar und, im Weiteren, auszubilden, zu koordinieren und einzusetzen ist.
Das stellt nochmals deutlich das Verhältnis von Menschen und Maschinen/Apparaten ins Zentrum der aktuellen Frage nach den kreativen Anteilen beider am gesellschaftlichen Gesamtprozess. Meistens wird das nur unter dem eingeschränkten und überholten Gesichtspunkt einer alles definitorisch auf sich beziehenden menschlichen Intelligenz gesehen. Das quasi-intelligente oder parallel-intelligente Verhalten von Maschinen folgt aber gerade nicht solchen Vorgaben, sondern einem anderen, autopoetischen, sich in noch nicht wirklich durchschaubarer Weise selbst organisierenden Muster.
Nur ein Stichwort dazu, zugleich eine Erinnerung: Karl Marx traute dem Kapitalismus, wie er ihn in seinen lange Jahrzehnte unveröffentlichten „Grundrissen zur Kritik der politischen Ökonomie“ von 1858/59 beschrieb, die Entwicklung einer Automatisierung der Maschinensphären zu, die insgesamt in der Lage ist, auf menschliche, also auf die „lebendige Arbeit“ zu verzichten. Wenn aber der ultimative Fortschritt der kapitalistischen Arbeitsgesellschaft darauf hinausläuft, menschliche Arbeit überflüssig zu machen, dann bricht das Fundament der philosophischen wie der politischen, der emanzipatorischen Bewusstseinsbildung, nämlich die Erfahrung der lebendigen Arbeit, die sowohl schöpferisch wie entfremdet ist, weg und in sich zusammen.
Die redaktionell benannten Fragen dieser Edition der Zeitschrift bleiben virulent. Einige finden schnell eine positive Antwort. Ja, man kann kreative Prozesse individuell, lebensgeschichtlich fördern. Der Pädagogik kommt hier eine zentrale Aufgabe zu. Ob digitale Werkzeuge benutzt werden oder im realen Raum kreative Prozesse stattfinden, ist prinzipiell gleichwertig. Entscheidend ist die Qualität der Kooperation, also der Selbstorganisation, von Solidarität und Zusammenwirken. Ohne Zweifel beeinflussen digitale Technologien und Künstliche Intelligenz das Konzept von Kreativität. Im Digitalen steckt jedoch leider vor allem nicht menschliche Kreativität, die von uns Menschen noch schwer zu verstehen ist. Welche nicht menschliche Kreativität konkret „im Digitalen steckt“, muss erst noch herausgearbeitet werden – durch tastende Versuche und Experimente in Künsten und Wissenschaften, durch Modelle und Projekte vielfältiger Art.
Eben dies ist die große Herausforderung der heutigen Zeit, also des Lebens im „digitalen Zeitalter“: Wir benötigen Modelle selbstorganisierten Lebens, einer Kooperation Freier und Freiwilliger zur wechselseitigen Sicherung der Subsistenz. Dazu bedarf es in der Tat ungeheurer kreativer Vermögen und Energien. Kleine Netze sind nötig, Autarkie, Selbstversorgung sind zentral. Noch stecken wir fest in der Falle der falschen Glücksversprechen der Apparate, die uns universale Wahlfreiheit, universalen Konsum, ubiquitäre globale und totale Informiertheit jederzeit instantan, auf einen Klick, versprechen. Und die uns, was wir denken, fühlen, leben wollen, das, was wir brauchen, vorgefertigt vorschlagen oder direkt anbieten. Solange wir bereit sind, uns der Steuerung durch die festlegenden Flüsse der „Big Data“ zu unterwerfen oder uns in der Illusion einer suspendierten Freiheit in ihre Sicherheitsversprechen einzugliedern, solange können wir nicht in dem Sinne, nämlich grundlegend, „kreativ“ sein, wie das nötig wäre. Also spitzt sich die Frage nach dem „Kreativen“ auf die Frage zu, ob wir uns die Lasten zutrauen, Freiheit in Eigenverantwortung erringen zu wollen, nach wie vor. Und nach wie vor müssen wir das selbst tun, macht das niemand für uns. Das können wir aber nur gemeinsam, nicht individuell – in Kooperationen und wahrscheinlich auch nur in kleinen Schritten.
Zitation
Reck, H. U. 2021: Stichwort „digitale Kreativität“ …. Im Rahmen des Projektes Digitales Deutschland. Online verfügbar: https://digid.jff.de/magazin/kreativitaet/digitale-kreativitaet/