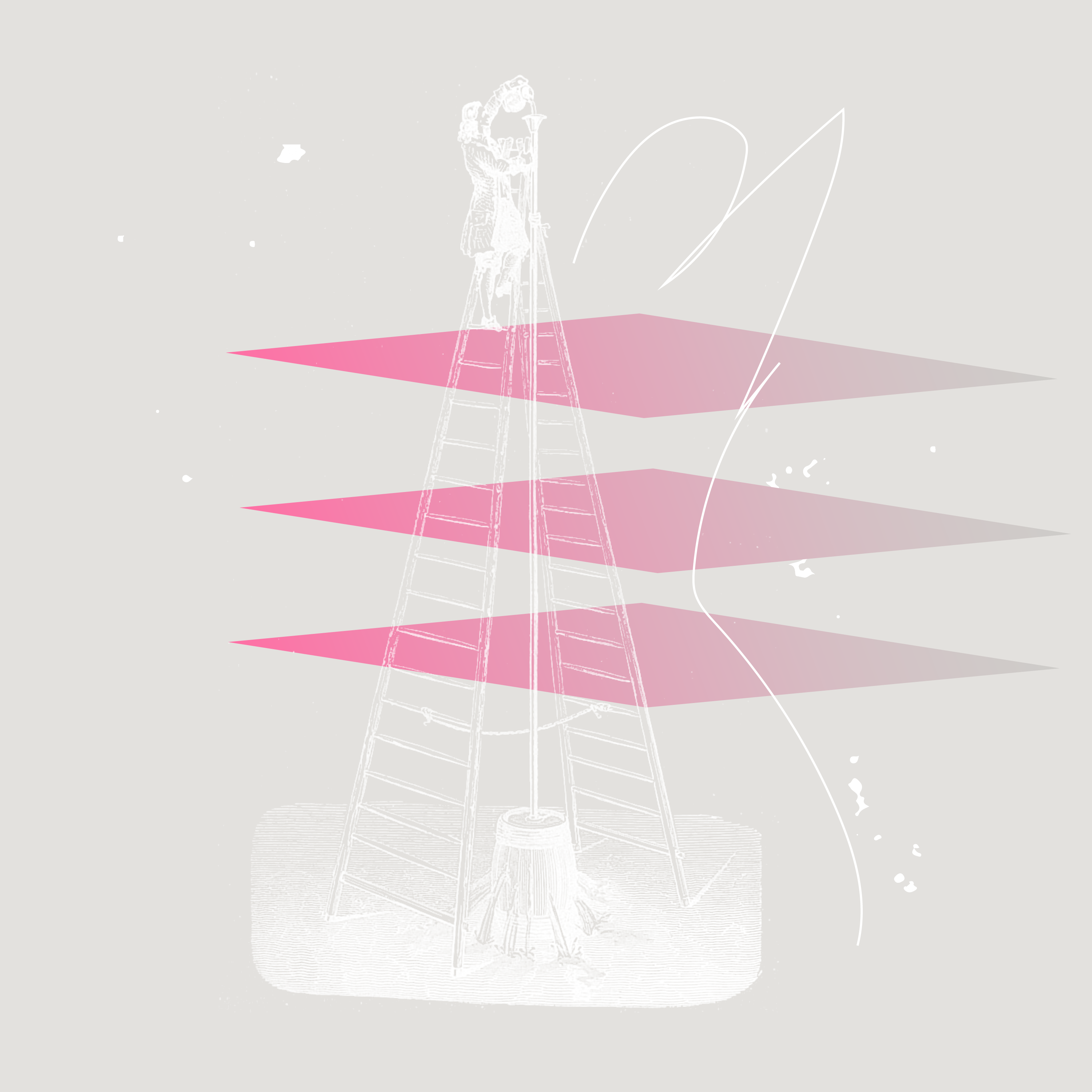

Auf dem Weg zum Wissensschatz der Caritas: Ein Gespräch über das digitale Datenprojekt „Lernende Systeme in der Beratung“
Auf dem Weg zum Wissensschatz der Caritas: Ein Gespräch über das digitale Datenprojekt „Lernende Systeme in der Beratung“
Das Einholen und strategische Verwenden von Kunden- oder Nutzer*innendaten scheint aus dem modernen Alltag nicht mehr wegzudenken zu sein – das damit verbundene Gefühl ist ein ambivalentes. Den positiven Nutzen der Erhebung und Auswertung von Daten mithilfe von Künstlicher Intelligenz nimmt aktuell der Deutsche Caritasverband e. V. (mit seinen Mitgliedsorganisationen) in den Fokus eines Projekts im Rahmen seiner digitalen Agenda. Im Zusammenhang mit seinen Mitarbeiter*innen sollen im 2020 gegründeten Pilotprojekt „Lernende Systeme in der Beratung“ Wissen, Ressourcen und Daten gebündelt und Künstliche Intelligenz „gemeinwohlorientiert zur Unterstützung der Sozialberatung in der Caritas“ entwickelt werden. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) im Rahmen der KI-Strategie des Bundes/KI-Zukunftsfonds und der „Agenda für smarte Gesellschaftspolitik“ gefördert.
Wir sprachen mit der Projektkoordinatorin Angela Berger – beim Verband als Referentin zuständig für digitale Kompetenzentwicklung – und dem Koordinator Digitale Agenda Johannes Landstorfer, verantwortlich für die Entwicklung einer Digitalstrategie des Verbandes.
Wann und woher kam der Anstoß zu „Lernende Systeme in der Beratung“?
Johannes Landstorfer (JL): Der Ursprungsgedanke war, dass wir festgestellt haben, dass wir an ganz vielen Stellen im Verband Daten erheben, aber nicht viel über die Situationen wissen, in denen wir arbeiten. Zum Beispiel in der Sozialberatung: Mit welchen Themen haben die Berater*innen gerade zu tun, mit welchen Fragen kommen die Ratsuchenden zu uns? Wir wollten uns also mehr mit den Daten beschäftigen – auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir uns im föderalen Verband natürlich hie und da schon mit dem Phänomen der Künstlichen Intelligenz auseinandergesetzt. Vor allem als sozial-ethisches Thema, das heißt in Hinblick auf die Auswirkungen in der Gesellschaft oder die ethischen Herausforderungen. Aber mein starker Eindruck war: Die Beobachter*innenperspektive reicht auf Dauer nicht, wir müssen näher rankommen, es selber ausprobieren – auch mit der Intention, dass wir einschätzen können, worin denn tatsächlich der Nutzen für unsere Dienste liegt und was es braucht, damit man diesen Nutzen überhaupt heben kann.
Warum die Bezeichnung „Pilotprojekt“? Eigentlich klingt die Idee des Teilens von Spezialwissen mittels KI – eines zentral verwalteten „Schwarmwissens“ also, in diesem Fall: des Wissensschatzes der Caritas – doch wie eine allumfassende Lösung, die in jedem größeren Verband oder Betrieb und nicht nur einem sozial orientierten auf der Hand liegen müsste.
Angela Berger (AB): Das „Pilotige“ des Projekts bezieht sich in erster Linie auf die Frage des systematischeren Einsatzes von Daten und KI-Technologie an dieser Stelle. Es ist der erste Versuch, um die Vor- und Nachteile zu betrachten und in der praktischen Anwendung die Fallstricke zu entdecken. Den Anwendungsfall „Wissensmanagement“ haben wir erst mit der Nutzer*innengruppe selbst entwickelt. Hier gibt es Strukturen, die vor allem auf Menschen aufbauen, den Fachberater*innen, die eine koordinierende, vernetzende Rolle spielen. Es gibt sehr, sehr viele Berater*innen, die natürlich unheimlich viel zu tun haben. Sie sind einzelnen Fachbereichen zugeordnet. Wir verfolgen einen Ansatz, der möglichst Fachbereiche miteinander vernetzt, die sonst vielleicht nicht so stark im Austausch stehen. Auch da können wir also technisch eine Brücke schlagen.
Von wie vielen Mitarbeiter*innen sprechen wir hier?
AB: Deutschlandweit arbeiten bei der Caritas beruflich fast 700.000 Menschen, ehrenamtlich noch einmal mehrere Hunderttausend, der Großteil davon in der Pflege und Altenpflege. Aus dem Migrationsbereich wissen wir, dass es in den Beratungsstellen ungefähr 500 Personen sind. Das ist nur eine von vielen Fachrichtungen, wenn auch eine der größten.
Und mit diesem Migrationsbereich beschäftigt sich das Projekt?
AB: Genau. Die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gefördert und folgt daher deutschlandweit einheitlichen Datensammel-Standards. Die Daten werden also sowieso konsolidiert beim Bundesverband – zumindest einmal jährlich.
JL: Das war eine der Leitlinien: Wir wollen keine neuen Daten erheben, sondern Daten verwenden, die schon da sind. Zu fast jedem Beratungsfall wird ja eine statistische Kurzform angelegt, mit verschiedenen Items. Wenn man jetzt sieht, wie viele Beratungskontakte wir jedes Jahr haben, sieht man auch, wie viele Daten dort entstehen, sogar mit richtig viel Aufwand.
Könnten Sie den konkreten Aufbau des Projekts einmal anhand eines Beispiels skizzieren? Bis hin zur idealen Anwendung aus Sicht der Nutzer*innen?
AB: Die Grundannahme ist: Aus den vielen Beratungsfällen heraus ergibt sich bei den Beratenden Erfahrung – Erfahrung mit bestimmten Fallkonstellationen. Eine verheiratete Person, die beim Jobcenter eine Unterstützung für einen Umzug beantragt. Jemand, die eine Kostenübernahme haben möchte für die Anerkennung ihres ausländischen Abschlusses. Solche Dinge lassen sich aus den statistischen Dokumentationen der letzten Jahre herausziehen. Innerhalb der Statistik steckt also viel Information darüber, womit sich die Berater*innen potenziell auskennen, worin sie Erfahrung haben. Damit dieses Wissen aufspürbar wird, soll das System, das wir aktuell „CariFIX“ nennen, im Idealfall über eine automatisierte Schnittstelle ein sogenanntes Expertise-Profil ableiten– natürlich nur nach Zustimmung der Beratenden –, das heißt: anhand bestimmter Konzepte abspeichern, wozu diese Person schon besonders viel in der Vergangenheit gemacht hat und also vielleicht auch Auskunft geben kann. Über dieses Expertise-Profil kann die Person dann im Tool CariFIX für andere Beratende auffindbar sein – für spezifische Fachfragen. Sagen wir, ich bin in der Migrationsberatung und ich habe eine Frage, die eher aus dem Bereich Schwangerschaftsberatung kommt. Ich habe aber eine gute Beziehung zu der ratsuchenden Person und möchte sie nicht einfach weiterverweisen. Ich brauche also diese bestimmte Expertise, die sich auch nicht einfach googeln lässt. Heißt: Ich suche eine Person, die sich schon mal mit der spezifischen Frage aus der Schwangerschaft auseinandergesetzt hat, gebe also meine Frage im System CariFIX ein und CariFIX schlägt mir vor, mit wem aus dem großen Caritas-Netzwerk ich dazu sprechen sollte. Diese Person kann ich kontaktieren und bekomme im Idealfall ein paar Antworten, die ich dann wiederum in meine Beratung einfließen lassen kann. Damit die Expert*innen nicht immer wieder Zeit für die gleichen Fragen aufwenden müssen, soll so eine Antwort auch in einem kleinen Wissensartikel formuliert werden, sodass die Suche nicht nur Menschen, also Expertise-Profile findet, sondern auch Artikel.
Die formulierten Ziele sind also: mehr Zeit und Qualität in der Beratung?
AB: Genau. Für unsere Ratsuchenden bedeutet das, eine gute, kompetente Beratung aus einer Hand bekommen zu können. Und nicht hin- und hergeschickt zu werden, noch einmal einen Termin ausmachen zu müssen und so weiter. Für Beratende: natürlich ebenfalls das Ziel, für die Ratsuchenden die beste Beratung anzubieten. Aber zeitlich in einem Maß, das zu stemmen ist, das heißt: in knapperer Zeit besser an Antworten zu kommen, nicht lange warten zu müssen, bis mir weitergeholfen wird, nicht jedes Mal von null recherchieren zu müssen. Aus Organisationssicht bedeutet es auch, sich ein Stück weit als gemeinsame Caritas aufzustellen und gemeinsam die beste Beratung anzubieten, die wir leisten können.
JL: Dazu muss man vielleicht sagen: Es gibt sehr unterschiedliche Beratungsstellen. In manchen müssen Sie zur nächsten Beraterin einfach nur ins nächste Büro gehen. Es gibt aber auch Fachzentren, innerhalb derer sich die andere Beratungsform in einem ganz anderen Gebäude befindet. Je nach Verbandsgröße kennen sich die Mitarbeiter*innen dann schon nicht mehr, obwohl sie zu einer Organisation gehören. Und es gibt Fälle, in denen die Verbände eine sehr große Fläche abdecken, da muss man schnell mal größere Strecken überwinden. Dies sind Situationen, in denen das System CariFIX helfen kann. Ein anderer Aspekt ist noch, dass Leute, wenn sie neu in die Beratung kommen oder das Beratungsfeld wechseln, wenn sie eben noch nicht über viel eigenes Netzwerk, eigene Berufserfahrung verfügen, sehr dankbar sind, wenn sie Anknüpfungspunkte bekommen.
Modul 1 des Projekts fand von November 2020 bis Juni 2021 statt. Aktuell läuft Modul 2. Auf wie viele Jahre ist das Projekt denn insgesamt ausgelegt?
AB: Wir sind an unsere Förderzeitläufe gebunden. Das Modul 2 läuft bis Ende dieses Jahres. Wie es danach weitergeht, ist leider noch nicht ganz klar.
JL: Wir haben noch ein drittes Modul vor: Das ist die Idee, ein fertiges Produkt in die Breite zu bringen. Was wir gerade haben, ist ein technischer „proof of concept“: Wir können zeigen, dass es grob funktioniert. Aber es ist noch nichts, was man im Arbeitsalltag einsetzen kann, was zum Beispiel ganz eng an die Arbeitsabläufe der Berater*innen angepasst ist und eine gewisse Breite an Funktionalitäten besitzt.
Spielt denn auch das Thema Datenschutz bei diesem Projekt eine Rolle?
AB: Sicher. Um das Ziel von CariFix zu erreichen, kommen wir zwar ohne personenbezogene Daten von Ratsuchenden aus. Beratende dagegen werden schon auf individueller Ebene identifizierbar. Wenn man über Erfahrungen und Fähigkeiten von Mitarbeitenden spricht, dann muss man auch als Dienstgeber*in schauen, dass man nicht in die Gefahr einer Leistungsüberprüfung oder eines Vergleichs kommt. Insofern müssen wir uns da schon mit datenschutzrechtlichen Fragen befassen und wollen das auch. Auch das ist Teil der Herausforderungen, die wir suchen wollten, um dafür Lösungen zu finden.
JL: Die Datenverarbeitung geschieht vor Ort in den Beratungsstellen. Wir ziehen also nicht alle Daten auf einen Bundesserver und machen dort die Analyse, sondern wir analysieren vor Ort und ziehen nur die Ergebnisse zusammen. Diese Schritte sind daraus entstanden, dass wir einen sensiblen Umgang mit den Daten haben wollten.
„Wie gemeinwohlorientierte KI gestalten? Praxiserfahrungen und Positionen zur Datenanalyse in sozialen Arbeitsfeldern“ – so lautete der Titel der Tagung, die Sie am 6. Oktober in Berlin initiiert haben. Was war der Fokus dieser Tagung? Was für Erkenntnisse haben Sie daraus gezogen, die Sie jetzt vielleicht mitnehmen in die weitere Projektarbeit?
AB: Die Tagung diente in erster Linie dazu, die Erfahrungen, die wir bis jetzt im Projekt gesammelt haben, weiterzugeben, darüber zu informieren, darüber ins Gespräch zu kommen, aber es auch noch einmal ein Stück größer zu denken. Wir haben mit der Entwicklung von CariFIX eine Art Tiefenbohrung gemacht und wollten die Erkenntnisse daraus jetzt zum einen in den Caritasverband als solchen tragen, aber das Ganze auch innerhalb der Wohlfahrt und mit Partner*innnen, die dazugekommen sind, diskutieren – diesen und verschiedene andere Anwendungsfälle, die gemeinwohlorientierte KI im Blick haben.
JL: Wenn wir hier jetzt vorangehen können, wollen wir das für alle machen. Vor allem mit den Wohlfahrtsverbänden haben wir im Digitalbereich sehr gute Kooperationen. Eine der Erkenntnisse aus der Tagung war, dass es sehr aufwendig ist, Künstliche Intelligenz im engeren Sinn einzusetzen. Mit unserem System sind wir ja noch gar nicht bei den schwergewichtigen Anwendungen. Es hat viele ökologische Aspekte, was die Hardware angeht und den Stromverbrauch. Das Ganze ist sehr ressourcenintensiv an Zeit und Kompetenzen. Auch die ethische Abschätzung fehlt noch. Insofern muss man schon auch mit Blick auf die Zukunft sagen: Man muss KI klug einsetzen, weil es so aufwendig ist.
AB: In der Gesellschaft wird viel über Regulierung gesprochen oder über Einsatz. Wenn die Ressource, die dafür zum Einsatz gebracht werden kann, so knapp ist: Wo wollen wir denn gemeinwohlorientierte KI? Und zwar tatsächlich im Sinne von: Wo nützt KI dem Gemeinwohl? Und nicht nur: Wer kann es sich leisten, sie zu entwickeln?
JL: Wichtig ist auch, dass vieles, was wir für Künstliche Intelligenz halten, eigentlich eine Form von Datenanalyse ist und nicht immer gleich die Technologien braucht, die man typischerweise als Künstliche Intelligenz bezeichnet. Oft geht’s auch einfacher. Auf diesem Weg befinden wir uns: Zu schauen, was heißt denn Datenanalyse überhaupt, was gibt es sonst noch für Maßnahmen?
Das System soll künftig die Rolle eines mit Berater*innen-Allwissen gefütterten Vermittlers übernehmen. Macht es die menschlichen Mitarbeiter*innen damit auf längere Sicht überflüssig?
AB: In der Arbeit mit Menschen ist das wirklich sehr schwierig. Wenn Menschen in die Beratung kommen, steht im Zentrum häufig das Beziehungsgeschehen. Es gibt genug, was man drumherum automatisieren kann, und im sozialen Bereich sind wir viel mehr von Fachkräfte- und Personalmangel betroffen als dass wir uns Sorgen machen müssten, dass hier Menschen ersetzt werden.
JL: Man könnte auch sagen: Schön wär’s, wenn man hier durch automatisierte Systeme Menschen ersetzen könnte und wir dadurch viel mehr Menschen beraten könnten. Aber so einfach ist es nicht. Weil eben dieses Beziehungsgeschehen wirklich schwer zu synthetisieren ist. Wir können aber schauen, wo wir Leute von Verwaltungsaufgaben befreien können, damit sie viel mehr Beratung machen können. Denn das ist genau das, was auch sie wollen.
Mehr zum Projekt unter: https://www.caritas-digital.de/projekte/lernende-systeme-in-der-beratung/
Zitation
Grenzmann, T. 2022: Auf dem Weg zum Wissensschatz der Caritas: Ein Gespräch über das digitale Datenprojekt „Lernende Systeme in der Beratung“. Im Rahmen des Projektes Digitales Deutschland. Online verfügbar: https://digid.jff.de/magazin/daten/interview-caritas/